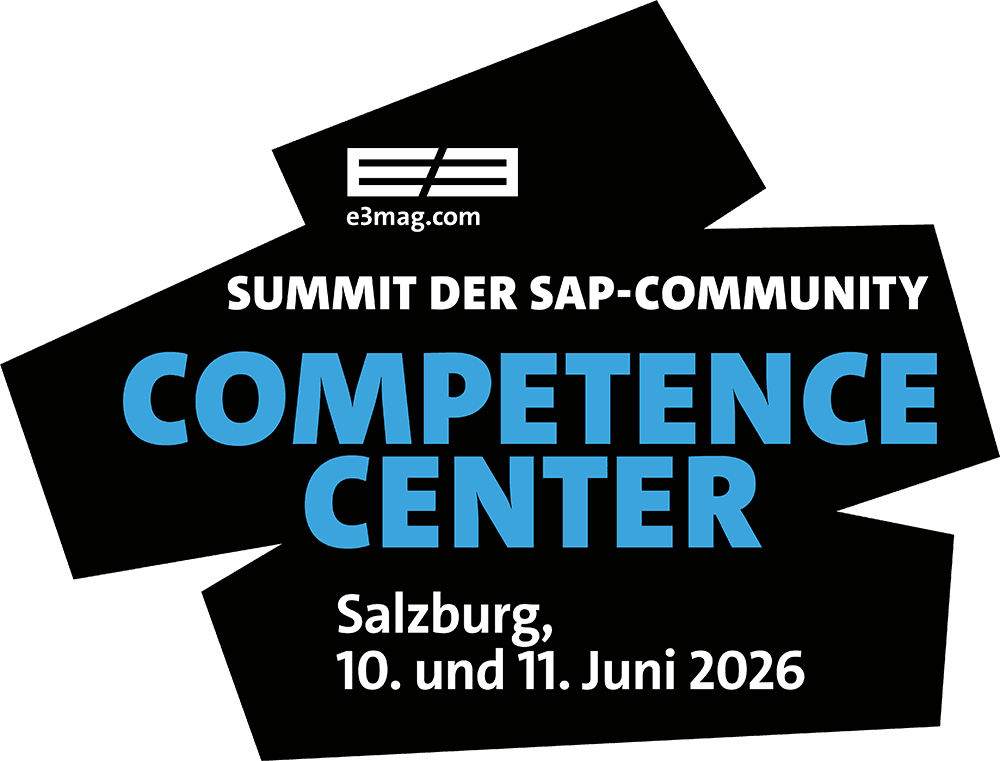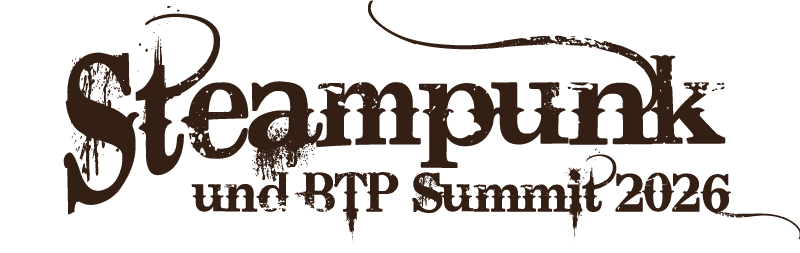Cloud zwischen Euphorie und Absturz


Die Entscheidung über die zukünftige ERP-Architektur stellt SAP-Bestandskunden im Zeitalter der digitalen Transformation vor ein komplexes Dilemma, das weit über die einfache Wahl zwischen dem eigenen Rechenzentrum (on-prem) und der externen Wolke (Private oder Public Cloud) hinausgeht. Während lange Zeit das klassische On-prem-System als ERP-Standard inklusive Virtualisierung dominierte, rückte in den vergangenen Jahren das Ideal der Cloud-Technik immer stärker in den Fokus der SAP-Community, wobei hybride und souveräne Modelle spezifische Herausforderungen und Risiken mit sich bringen, die es zu meistern gilt.
Das traditionelle On-prem-Modell, bei dem die Software auf unternehmenseigener Hardware betrieben wird, bietet den ERP-Anwendern die volle Hoheit über Daten, Geschäftsprozesse und Lizenzen. Zudem ermöglicht es eine vollständige Kon-trolle und Anpassbarkeit der Compliance–Maßnahmen und der individuellen Geschäftsprozesse (Abap-Modifikationen). Diese ERP-Autonomie wird jedoch teuer erkauft: On-prem-Lösungen sind mit hohen Anschaffungskosten für Hardware und Software verbunden, müssen auf potenzielle Lastspitzen ausgelegt sein, was unnötig hohe Kosten verursacht, und sind stark vom Fachkräftemangel betroffen sowie von qualifiziertem IT-Personal abhängig, das für den 24/7-Betrieb benötigt wird. Zudem können Altsysteme oftmals neue Techniken wie KI oder Analytics nicht unterstützen. Hierbei können jedoch SAP-Bestandskunden auf die Business Technology Platform (SAP BTP) ausweichen, die auch in Kombination mit einer On-prem-Business-Suite 7 betrieben werden kann.
Die Public Cloud der Hyperscaler (wie AWS, Azure oder GCP) geht den umgekehrten Weg: Sie bietet Services öffentlich über das Internet an, nutzt eine Multi–Tenant-Struktur und lockt mit hoher Flexibilität und elastischer Skalierbarkeit sowie einer nutzungsabhängigen Abrechnung (Pay-as-you-go). Doch dieser Komfort ist für SAP-Bestandskunden nicht risikofrei. Die Annahme, die Public Cloud sei generell kostengünstiger als der Inhouse-Betrieb, hat sich in den vergangenen Jahren nicht bewahrheitet. Viele SAP-Bestandskunden haben ihre Rechenzentren in den vergangenen Jahren optimal orchestriert.
Hingegen berichten ERP-Anwender von einem Gefühl der Hilflosigkeit bei Serviceausfällen, da der direkte Zugriff auf das Rechenzentrum und die eigenen IT-Mitarbeiter fehlt. Und das Konzept der Cloudifizierung bedeutet nicht automatisch Simplifizierung, da die Komplexität des Rechen-zentrumsbetriebs, siehe auch Rise with SAP, bestehen bleibt. Hinzu kommen das Risiko des Vendor Lock-in und Sicherheitsbedenken, da die wertvollen Unternehmensdaten sich außerhalb der Unternehmens-Firewall befinden.
Hybrid Cloud
Aufgrund dieser Spannungsfelder entwickelte sich die Hybrid Cloud. Dieses Cloud Computing kombiniert On-prem- und Private/Public-Cloud-Ressourcen und ermöglicht es, sensible Daten lokal zu halten, während skalierbare Cloud-Services und Angebote von Drittanbietern wie Salesforce (CRM) und Workday (HCM) genutzt werden. Die zentrale und größte Herausforderung liegt hierbei jedoch in der Orchestrierung der IT-Landschaft. Das Management hybrider Systeme erfordert die Integration unterschiedlicher Betriebsmodelle und Service Level Agreements (SLAs). Die Interoperabilität zwischen den oft organisch gewachsenen On-prem-Lösungen und den cloudnativen Services unterschiedlicher ERP-Anbieter muss mühsam sichergestellt werden. Darüber hinaus ist das Verschieben von Workloads und großen Datenmengen zwischen den IT-Welten technisch aufwändig und kann bei großen Systemen zu langen Laufzeiten führen, was eine hohe Netzwerkbandbreite voraussetzt.
Eng verbunden mit der Hybrid-Strategie ist der Wunsch nach digitaler Souveränität, der insbesondere in Deutschland hoch im Kurs steht, da viele SAP-Bestandskunden eine Datenhaltung und -verarbeitung in eigenen oder gehosteten Rechenzentren vor Ort erwarten. Die souveräne Cloud oder spezifische Private-Cloud-Modelle (wie HPE GreenLake) zielen darauf ab, die Hoheit über geschäftskritische Daten zu sichern und gleichzeitig Cloud-Vorteile wie Flexibilität und verbrauchsabhängige Abrechnung zu bieten. Die Herausforderung hier ist die hohe Komplexität von Vorschriften und Governance, da strenge regulatorische Anforderungen (etwa in regulierten Branchen wie dem Gesundheits- oder Finanzwesen) vorschreiben können, dass bestimmte ERP-Daten das eigene Haus nicht verlassen dürfen. Die Cloud-Nutzung in globalen Szenarien, insbesondere mit Anbietern außerhalb der EU, erfordert höchste Vorsicht und eine intensive Auseinandersetzung mit rechtlichen Rahmenbedingungen wie der DSGVO und potenziellen Einflüssen durch den Cloud Act, um Incompliance zu vermeiden.
Die umfassende Transformation von SAP-Bestandskunden hin zu S/4, insbesondere im Rahmen der Cloud-Strategie Rise with SAP, ist weit mehr als nur ein technisches Up-grade; die S/4-Conversion ist eine betriebswirtschaftliche, organisatorische, technische und nicht zuletzt lizenztechnische Herausforderung. Die Herausforderungen, Risiken und Gefahren sind vielschichtig und berühren kritische Bereiche wie Kostenkontrolle, Datensicherheit und Autonomie. Eine der größten Hürden stellt die wirtschaftliche Rechtfertigung dar, da die hohen Kosten eines ERP-Releasewechsels oft den Nutzen in der ROI-Analyse aufwiegen. Diese Kosten werden maßgeblich durch die komplizierte SAP-Lizenzierung bestimmt. Die SAP-Preisliste für S/4 ist ein komplexes Werk von über 200 Seiten, das mit Optionen wie Digital Access und SAP OpenHub die Kundenbasis verunsichert. Besonders heikel ist das Thema der indirekten Nutzung, da die Lizenzierung von Digital Access die vertragliche Zustimmung impliziert, dass Belege, die über Schnittstellen in das SAP-System importiert werden, lizenzpflichtig sind. Wurde dieses Thema in der Vergangenheit juristisch mitunter ausgehebelt, so gilt es nach einer Lizenzierung von Digital Access als geklärt, wobei das Risiko teurer Nachzahlungen oder einer Überlizenzierung hoch bleibt.
Mit dem Abo- und Subskriptionsmodell von Rise with SAP entstehen für Bestandskunden tiefgreifende Abhängigkeiten. Die Umwandlung der existierenden unbefristeten On-prem-Lizenzen in Cloud-Subskriptionen erfolgt über das komplexe Regelwerk des Full Use Equivalent (FUE), siehe auch E3-Coverstory Oktober 2025. Dieser Prozess ist für den SAP-Bestandskunden faktisch irreversibel und führt zum Verlust der Autonomie über das ERP-System, da das Eigentum an der Software vom Kunden auf SAP übergeht und ein Mietverhältnis entsteht. Diese Umwandlung ist mit der Sorge vor einer Kostensteigerung verbunden. SAP räumt zwar ein, dass die Migration in die Cloud mit FUE nicht zwangsläufig zu höheren Einnahmen für SAP führen muss, doch die Befürchtung einer Erhöhung der Berechnungsgrundlage um 20 bis 50 Prozent nach dem Wechsel in die Cloud besteht weiterhin. SAP-Chef Christian Klein hat bei der Hauptversammlung 2025 gemeint, dass die Umsätze pro Bestandskunde durch Rise um das Drei- bis Vierfache zulegen.
Das Fehlen einer nachhaltigen Cloud-Exit-Strategie seitens SAP wird als existenzielle Gefahr für Kunden betrachtet. Scheitert eine Rise-Conversion, steht der Kunde mit den Trümmern seines ERP-Systems da, ohne in die Cloud gelangt zu sein, aber mit entzogenen On-prem-Lizenzen, was das Risiko einer doppelten Bezahlung mit sich bringen kann.
Auf technischer Ebene bringt die S/4-Transformation hohe Risiken mit sich. Die Lösung von Datenproblemen gilt als größte Herausforderung. Die Konsolidierung von Debitor- und Kreditor-Stammdaten in den neuen Geschäftspartner-Ansatz ist kritisch, da historisch gewachsene Systeme oft unter schlechter Datenqualität, Dubletten und mangelnden Strukturen leiden. Der Ballast von Altdaten und Legacy-Informationen behindert zudem die Rückkehr zum SAP-Standard (Clean Core) und zieht Projekte in die Länge.
Die von SAP propagierte Clean-Core-Strategie, die Modifikationen und Eigenentwicklungen aus dem S/4-Kern verbannt, kollidiert mit dem traditionellen Individualisierungsgrad vieler ERP-Systeme. Für Kunden mit einem stark „verschmutzten“ Core und umfangreichen Z-Entwicklungen ist der Umbau extrem komplex und arbeitsintensiv, was zu hohen zeitlichen Verzögerungen führen kann. Zukünftige Anpassungen müssen außerhalb des Kernsystems, beispielsweise über die Business Technology Platform, erfolgen, was zusätzlichen architektonischen Aufwand und die Notwen-digkeit neuen Know-hows in den IT-Ab-teilungen nach sich zieht. Zum Thema Clean Core und BTP gibt es am 22. und 23. April in Heidelberg einen Summit der SAP-Community.
Obwohl SAP und die Hyperscaler ein hohes Sicherheitsniveau bieten, trägt der ERP-Anwender auch in der Cloud weiterhin die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance und korrekte Lizenzierung – auch mit Rise with SAP. Die Verarbeitung sensibler Daten in der Public Cloud, insbesondere bei Cloud-Anbietern mit Sitz außerhalb der EU, ist aufgrund von Gesetzeswerken wie dem Cloud Act, der DSGVO-Regularien aushebeln kann, mit Vorsicht zu genießen. Hinzu kommt die Gefahr, dass SAP alle Daten in der Cloud löschen darf, sobald der Vertrag endet, was die Kunden zur proaktiven Sicherung der Daten vor Vertragsende zwingt. Hier vermissen SAP-Bestandskunden oft die schon erwähnte fehlende Cloud-Exit-Strategie.
Angesichts des nahenden Endes der Mainstream-Wartung für ERP/ECC 6.0 bis spätestens 2030 oder auch 2033 sehen sich SAP-Bestandskunden gezwungen, strategische Entscheidungen zu treffen. SAP begegnet dieser Herausforderung mit dem umfassenden Angebot Rise with SAP, das als Business Transformation as a Service (BTaaS) konzipiert ist und den Weg in die Cloud vereinfachen und beschleunigen soll.
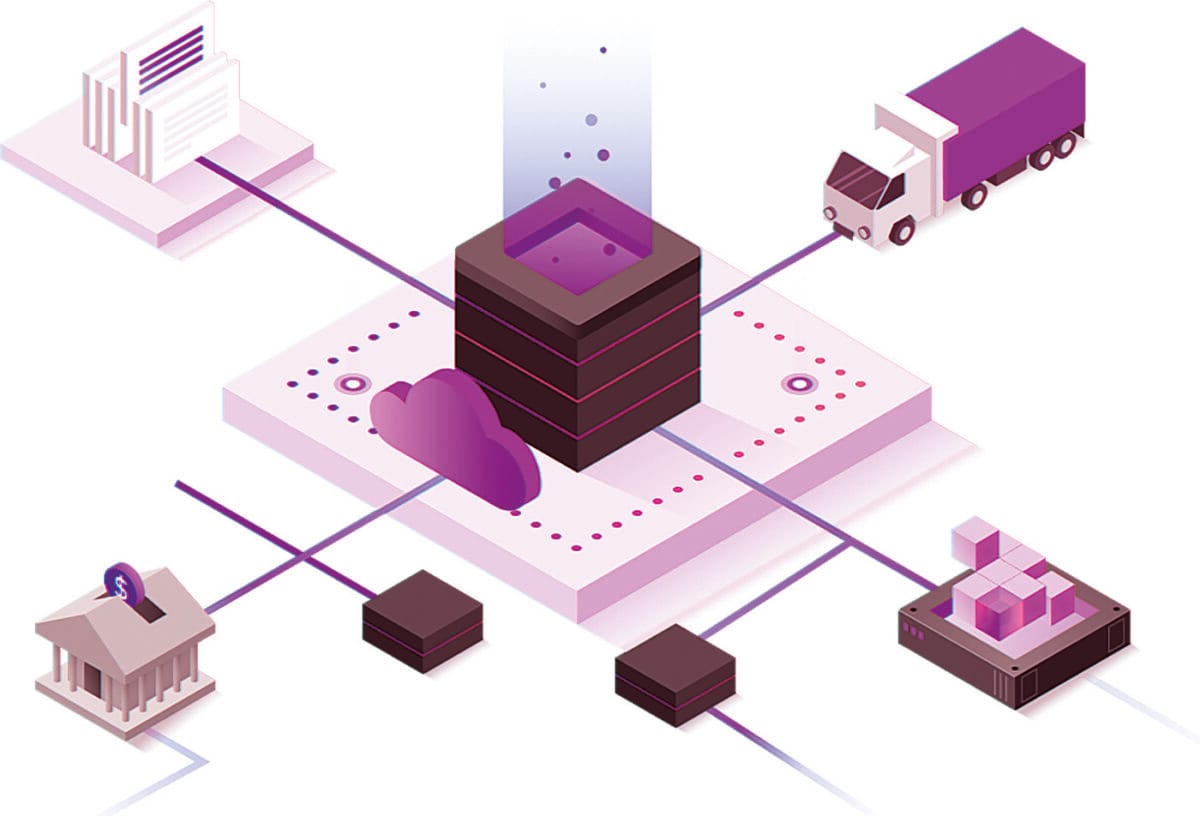
Die strategische Cloud-Transformation mit Rise beginnt nicht mit der Technik, sondern mit der Klärung der mittel- und langfristigen Geschäftsstrategie, aus der die Ziele für die S/4-Conversion abgeleitet werden müssen. Die Frage, welches Deployment-Modell das passende ist – On-prem, Public Cloud oder Private Cloud –, ist dabei von elementarer strategischer Bedeutung und muss ergebnisoffen geprüft werden. Obwohl SAP eine klare Cloud-First-Strategie verfolgt und diese in den vergangenen Jahren immer stärker forciert hat, zeigt sich in der Realität, dass hybride Systemlandschaften für die meisten SAP-Bestandskunden die Regel sind.
Das Rise-Angebot bündelt verschiedene Kernkomponenten in einem einzigen Abonnementvertrag, um die Komplexität zu reduzieren und SAP als Generalunternehmer zu positionieren. Es umfasst neben dem Cloud-ERP S/4 (in Private oder Public Edi-tion) auch die Business Technology Platform, Business Process Intelligence (Signavio), das SAP Business Network sowie integrierte Tools und Services. Die BTP fungiert dabei als technologische Brücke und Innovationsplattform, die Side-by-Side-Erweiterungen ermöglicht und damit die wichtige Clean-Core-Strategie unterstützt. Diese Strategie, die darauf abzielt, das Kernsystem so nah wie möglich am SAP-Standard zu halten, ist entscheidend, um kontinuierlich von Innovationen und Updates zu profitieren, und ist sowohl für die Public als auch die Private Cloud relevant. Innerhalb von Rise können S/4-Bestandskunden zwischen zwei Haupt-Deployment-Optionen wählen: der Cloud Public Edition und der Cloud Private Edition. Die Public Cloud, die auf einem Multi-Tenant-Modell basiert, eignet sich für Unternehmen, die standardisierte Prozesse verfolgen und geringste Total Cost of Ownership (TCO) anstreben, lässt jedoch nur begrenzte Konfiguration und Anpassung zu. Hingegen richtet sich die Private Cloud Edition (PCE), die technisch als PaaS/SaaS in einer dedizierten Public-Cloud-Umgebung läuft, an mittlere und große SAP-Bestandskunden mit komplexen und individuellen Anforderungen.
Der Erfolg der S/4-Conversion, insbesondere in die Cloud, hängt maßgeblich von einer sorgfältigen Vorbereitung und der Beseitigung von Altlasten ab. Experten raten, die Transformation als große Chance für die Datenharmonisierung zu nutzen, die idealerweise vor dem eigentlichen Umstieg erfolgt. Eine zentrale Anforderung sind die Bereinigung und Konsolidierung von Kunden- und Lieferantenstammdaten, da diese in S/4 obligatorisch in das neue Datenmodell des Geschäftspartners (Business Partner, BP) überführt werden müssen. Des Weiteren sollte die Transformation mit dem Aufbau einer separaten, kontextbewussten Datenschicht verbunden werden, um Altsysteme stillzulegen und die Datenmenge, die in das neue S/4-System migriert wird, massiv zu reduzieren, was Kosten senkt und den Umstieg beschleunigt. Auch der Umgang mit kundeneigenem Abap-Code (Custom Code) ist kritisch; hierfür sind Werkzeuge wie der SAP Readiness Check und das Abap Test Cockpit essenziell, um die notwendigen Anpassungsaufwände frühzeitig zu ermitteln und den Code idealerweise auf die BTP auszulagern (um den Clean Core zu gewährleisten).
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Wahl der Cloud-Strategie mit Rise with SAP ein komplexes Unterfangen ist, das für die meisten SAP-Bestandskunden über die Private Cloud Edition und hybride Architekturen führt.
Buchtipps
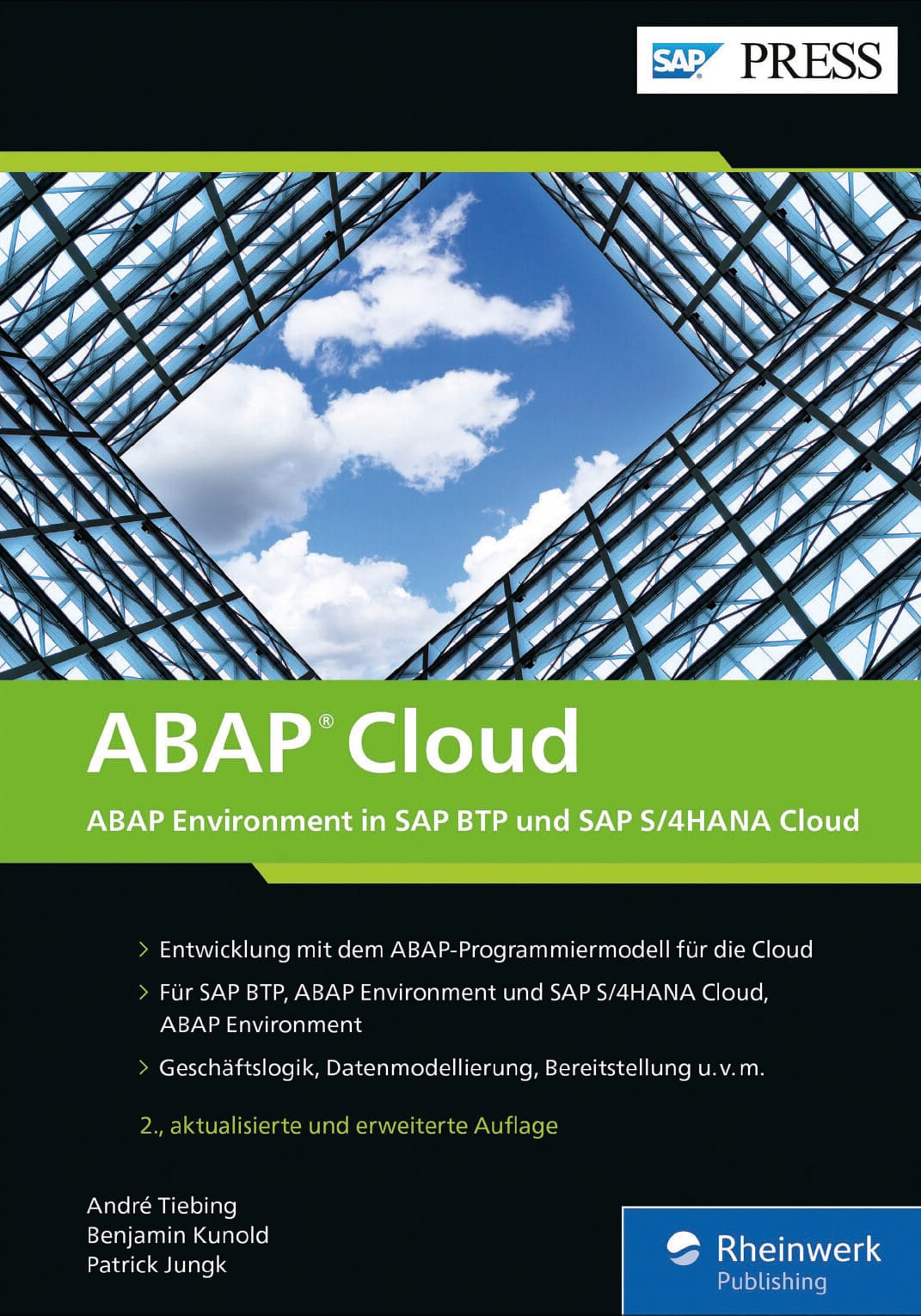
André Tiebing, Benjamin Kunold,
Patrick Jungk, 2025, 606 Seiten,
ISBN 978-3-367-10239-6
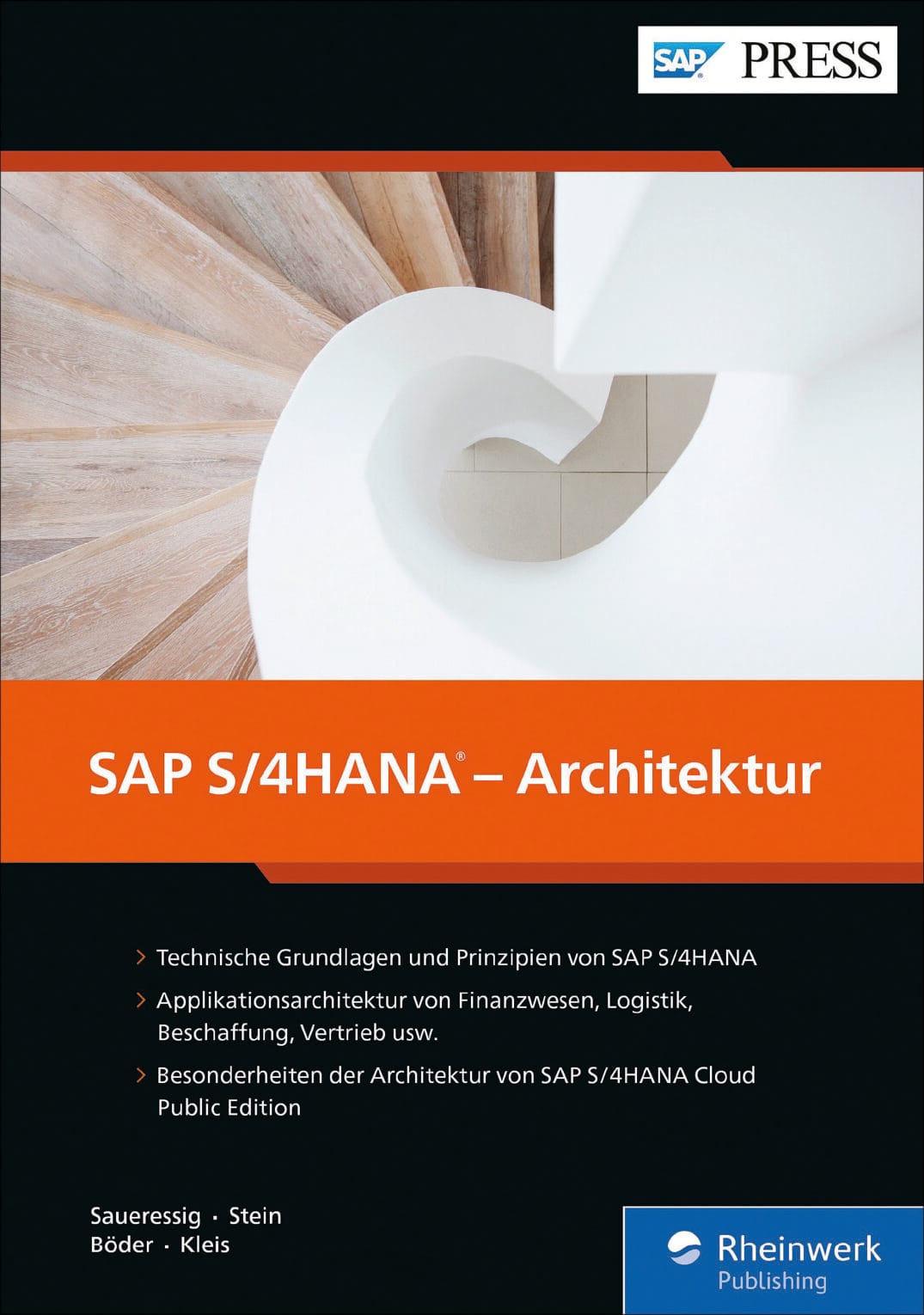
Thomas Saueressig, Tobias Stein,
Jochen Boeder, Wolfram Kleis,
2024, 644 Seiten, ISBN 978-3-8362-9479-9
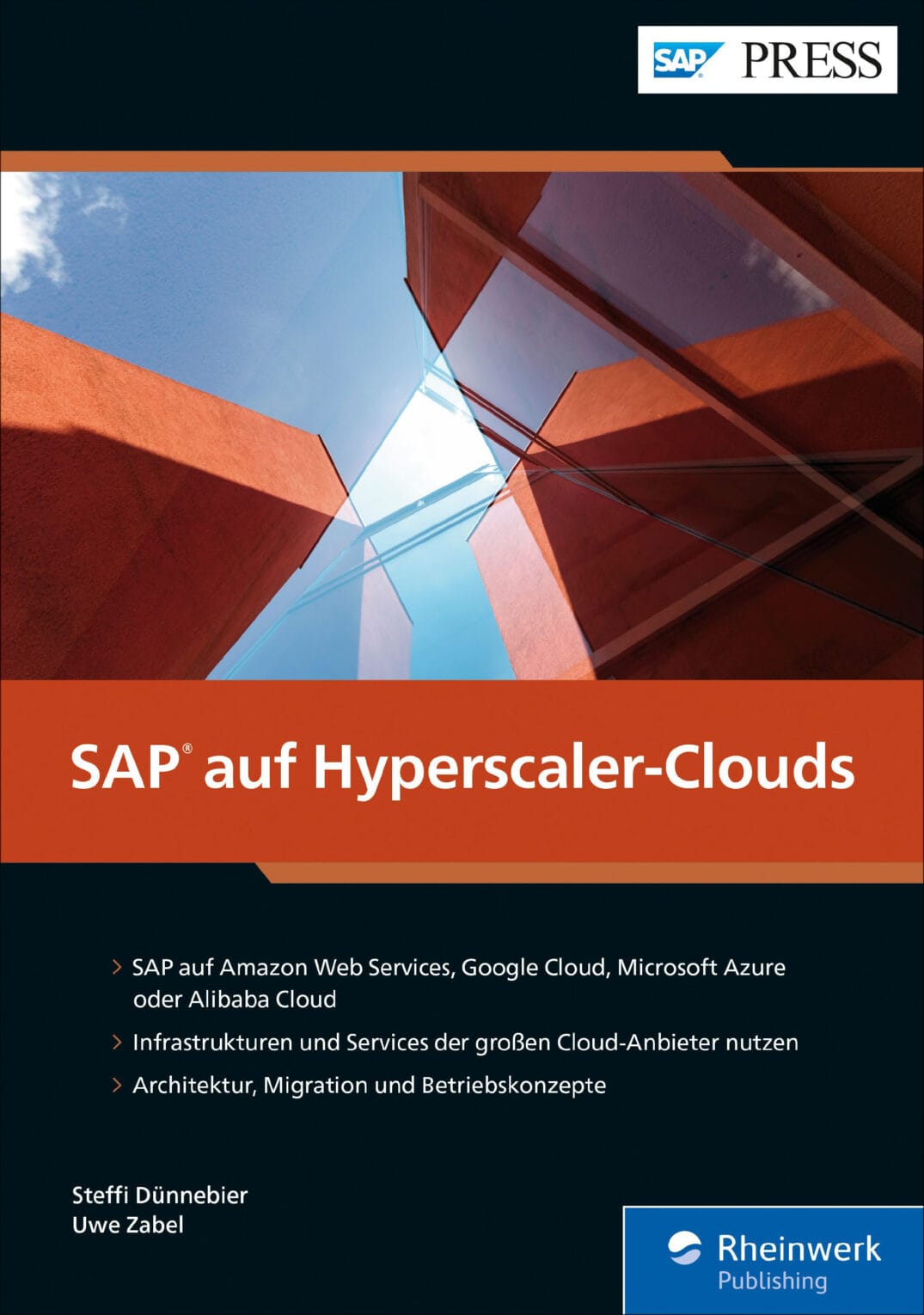
Steffi Dünnebier, Uwe Zabel
2023, 457 Seiten, ISBN 978-3-8362-9239-9
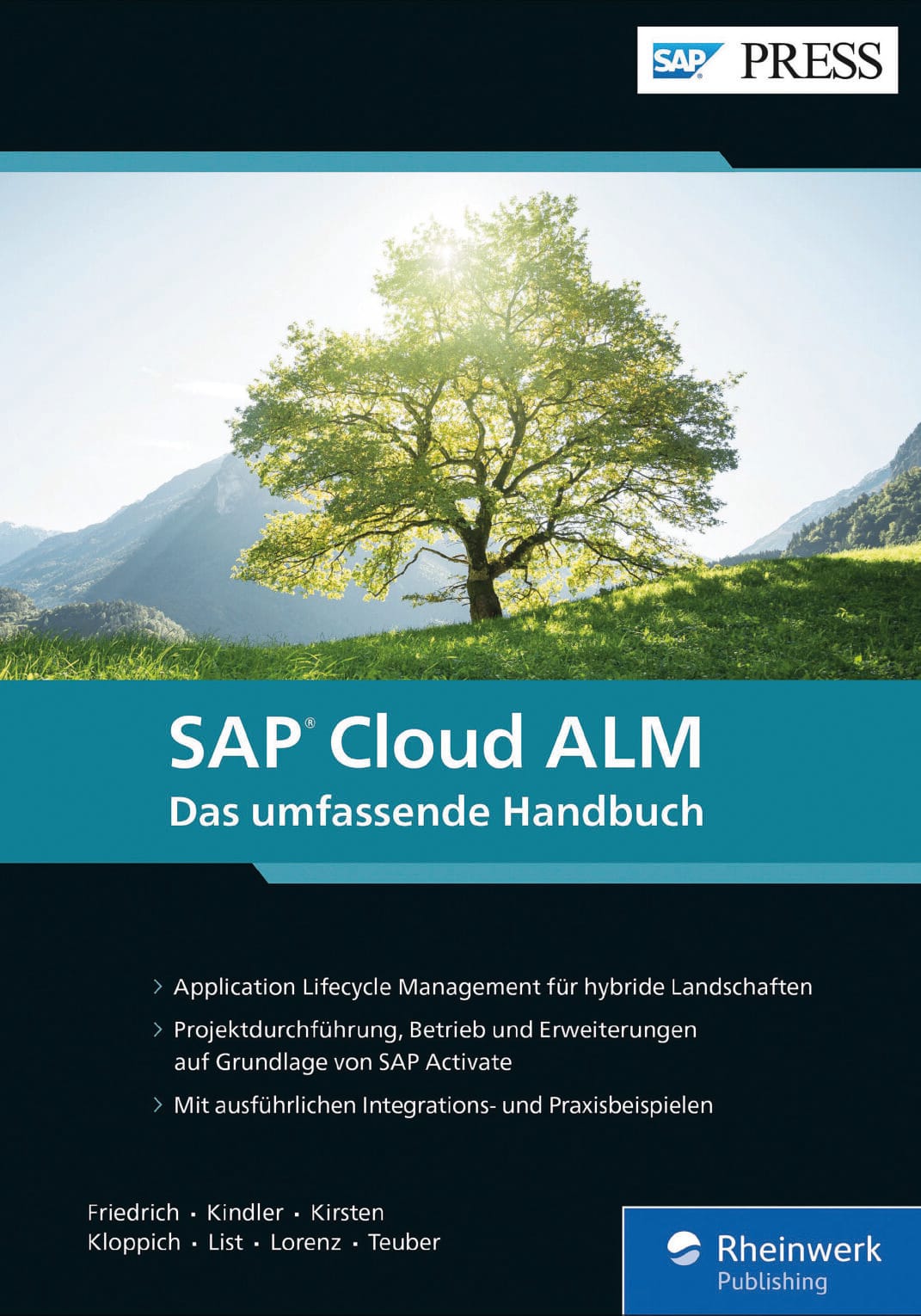
Matthias Friedrich, Fred Kindler,
Marcel Kirsten, Daniel Kloppich,
Mathias List, Bert Lorenz, Lars Teuber
2023, 651 Seiten, ISBN 978-3-8362-9464-5
Vom SolMan zu Cloud ALM
Der Umstieg vom SolMan (SAP Solu-tion Manager) auf SAP Cloud ALM (Application Lifecycle Management) stellt SAP-Bestandskunden vor eine der größten strategischen und operativen Herausforderungen im Zuge der S/4-Conversion.
Mit dem angekündigten Ende der Mainstream-Wartung für den SolMan 7.2 Ende 2027 (mit erweiterter Wartung bis 2030) müssen Unternehmen ihre ALM-Strategie neu ausrichten. Cloud ALM wird von SAP als die strategische ALM-Lösung für alle SAP-Bestandskunden positioniert. Es handelt sich um eine native Public-Cloud-Anwendung, die vollständig aus der Cloud kon-sumiert wird und sich primär an Kunden richtet, die cloudzentrierte Lö-sungen wie S/4 Cloud, SuccessFactors oder das SAP-CX-Portfolio einsetzen oder planen. Im Gegensatz zum SolMan lässt sich Cloud ALM schnell in Betrieb nehmen und liefert rasch erste Moni-toring-Daten. Die Nutzungs-rechte für SAP Cloud ALM sind im Rahmen von Supportverträgen wie dem SAP En-terprise Support, Cloud Editions, ent-halten. Trotz dieser strategischen Neuausrichtung birgt der Umstieg erhebliche Herausforderungen und Risiken für langjährige SolMan-Nutzer, da Cloud ALM keine vollwertige Alternative zum SolMan darstellt. Der Funktionsumfang des SolMan, der ein wesentlich breiteres Spektrum an Funktionen für den gesamten Anwendungslebenszyklus (einschließlich Projektmanagement, Monitoring, Incident Management, Change Management und Testmanagement) bietet, wird von Cloud ALM aktuell nicht erreicht. Insbesondere fehlen SAP Cloud ALM das Lifecycle Management für die SAP Business Suite und Non-SAP-Applikationen sowie Funktionen für das IT Service Management (ITSM).
Das größte Risiko liegt in der Eignung für hybride Umgebungen. Während der SolMan in der Vergangenheit auf On-prem- und hybride Landschaften zugeschnitten war, erscheint SAP Cloud ALM derzeit völlig ungeeignet für hybride Systemlandschaften, da es primär auf die Public Cloud ausgerichtet ist. Kunden, die weiterhin Teile ihrer SAP-Landschaft on-prem oder in der Private Cloud betreiben, müssen klären, inwieweit Cloud ALM diese heterogenen Topologien wirkungsvoll unterstützen kann.
Die Umstellung bedeutet zudem einen tiefgreifenden Wandel der Rolle der SAP-Basis-Abteilung (vom CCC zum CCoE): Statt eigene Systeme zu pflegen, verlagern sich die Aufgaben hin zur Koordination, zum Provider Management und zur Annahme von Geschäftsanforderungen, die an SAP oder Hyperscaler weitergegeben werden. Ein weiteres Risiko besteht in der lizenztechnischen Abhängigkeit, da das Nutzungsrecht für Cloud ALM sofort erlischt, wenn der Bestandskunde den SAP-Support kündigt.
Zusammenfassend bildet SAP Cloud ALM, integriert mit Signavio und Lean-IX sowie dem SAP Business Transformation Center für die Datenmigration, eine Plattform, die das Management von Datentransformation, Innovationen und systemübergreifender Business Continuity gewährleisten soll. SAP verfolgt damit das Ziel, eine umfassende Grundlage für KI-gesteuerte Pro-zess-optimierung zu schaffen.
Hyperscaler: Freund und Feind
Der Weg in die Cloud ist für SAP-Bestandskunden längst unumgänglich, doch die Entscheidung, welche Cloud die optimale ist, gleicht einer strategischen Gratwanderung zwischen SAPs eigenen Angeboten wie Rise with SAP und der direkten Nutzung der Infrastruktur großer Hyperscaler.
Die Hyperscaler – allen voran Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und die Google Cloud Platform (GCP) – bieten eine Deployment-Option, die als Infrastructure as a Service (IaaS) bezeichnet wird und sich fundamental von den paketierten SAP-Lösungen der Private Cloud Edition (PCE) oder der Public Cloud Edition unterscheidet.
Die Hauptattraktivität eines SAP-Systems, das direkt auf einem Hyperscaler im IaaS-Modell betrieben wird, liegt in der maximierten Flexibilität und Agilität. Im Gegensatz zu den starren, vordefinierten Hardware-Anforderungen eines On-prem-Systems ermöglicht die Hyperscaler-Plattform eine elastische Skalierbarkeit. Ressourcen, wie beispielsweise für Entwicklungs-, Test- oder Sandbox-Systeme, können innerhalb weniger Stunden bereitgestellt oder dynamisch hochgefahren und wieder heruntergefahren werden. Dies bietet nicht nur Investitionssicherheit, sondern ermöglicht auch einen zeitlich flexiblen Betrieb, der bei Nichtnutzung der virtuellen Maschinen (VMs) minutengenau abgerechnet wird – ein wesentlicher Faktor zur Senkung der Betriebskosten (TCO). Einige Studien weisen auf Kosteneinsparungen von 40 bis 75 Prozent für den SAP-Betrieb auf Azure hin oder auf jährliche Einsparungen von über drei Millionen US-Dollar durch die Migration der SAP-Infrastruktur auf Google Cloud.
Ein weiterer entscheidender Vorteil des Hyperscaler-Ansatzes (IaaS) ist die Möglichkeit, vorhandene SAP-Lizenzen weiter zu nutzen (Bring Your Own License, BYOL). Dies erlaubt es Bestandskunden, ihre gekauften On-prem-Lizenzen in die Cloud mitzunehmen, ohne sofort auf das Subskriptionsmodell umstellen zu müssen, das mit Rise with SAP verbunden ist. Die serverlosen, fully managed Lösungen der Hyperscaler ermöglichen eine hohe Innovationsgeschwindigkeit, die über das hinausgeht, was SAP selbst im Kernsystem bietet.
Im Vergleich dazu ist Rise with SAP – das oft auf denselben Hyperscalern gehostet wird, aber als Private Cloud Edition läuft – ein gebündeltes Gesamtpaket. Es bietet dem Kunden zwar einen einzigen Ansprechpartner (One Face to the Customer), schränkt jedoch die Flexibilität ein, da es Software, Hosting und Betrieb in einer einzigen Subskription zusammenfasst. Wer auf Hyperscaler IaaS setzt, kann dagegen individuelle Verträge mit Hyperscalern und Dienstleistern aushandeln und die Lizenzen über die gesamte IT-Infrastruktur hinweg optimieren.
Trotz dieser Vorteile ist der Betrieb von SAP auf Hyperscaler-Clouds mit erheblichen Risiken und Herausforderungen verbunden. Eines der zentralen Probleme ist, dass der Lift and Shift eines alten ERP-Systems auf die Hyperscaler-Infrastruktur zwar die Infrastruktur-ebene modernisiert, aber das alte ERP auf Software-Ebene beibehält. Die wahren Vorteile von SaaS, wie Agilität und Innovation, können so verpasst werden.
Nicht zuletzt stellen die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Datensicherheit eine große Hürde dar. Die Migration von SAP-Systemen in die Cloud, insbesondere in die Public Cloud eines Hyperscalers, ist technisch aufwändig. Für regulierte Branchen gelten besondere, oft branchenspezifische Gesetzesregelungen, die die Cloud-Nutzung komplex machen. Die Einhaltung der Compliance (z. B. DSGVO) muss der Kunde in der Public Cloud sehr ernst nehmen und aktiv adressieren. SAP selbst versucht zudem, Cloud-Innovationen wie KI in S/4 nur noch für seine Cloud-Lösungen anzubieten, was On-prem-Bestandskunden oder IaaS-Anwender außerhalb von Rise potenziell benachteiligen könnte. Die Entscheidung für SAP auf einem Hyperscaler erfordert daher die sorgfältige Abwägung zwischen der gewonnenen Infrastrukturflexibilität und der erhöhten Managementkomplexität sowie den Unsicherheiten bei Kosten und Compliance.