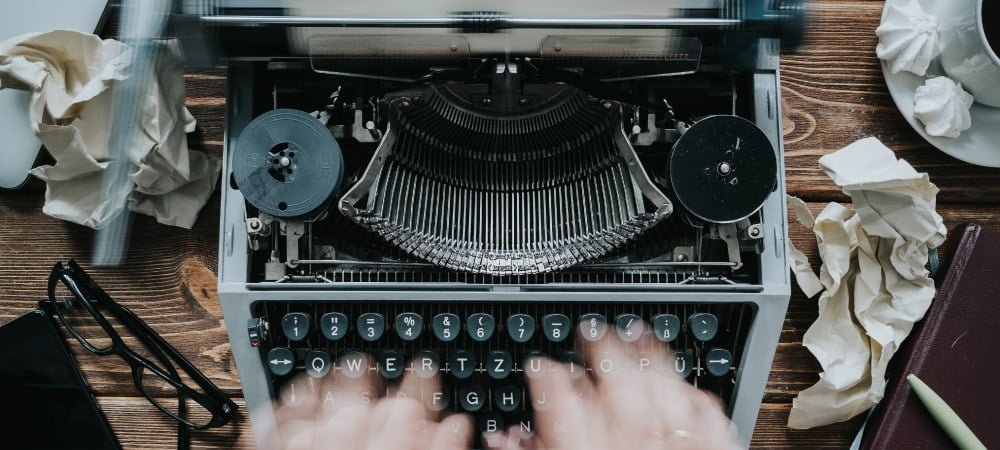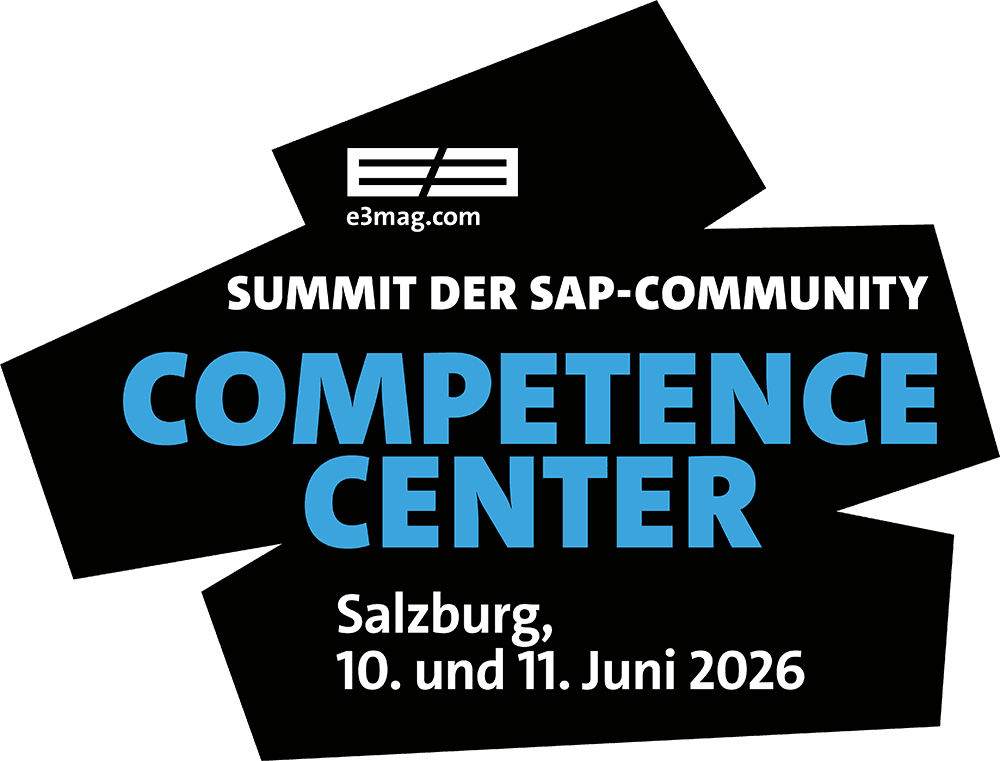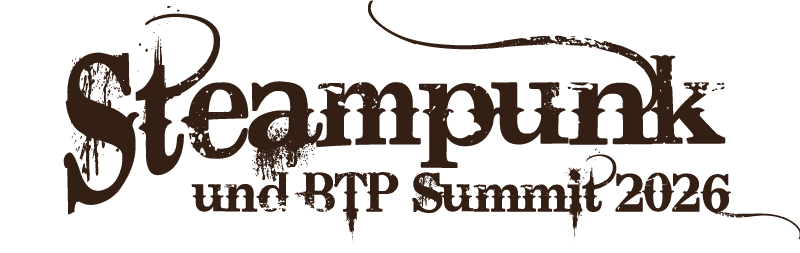Fujitsu BestPlace: Datengetrieben zur besten SAP-Platzierung
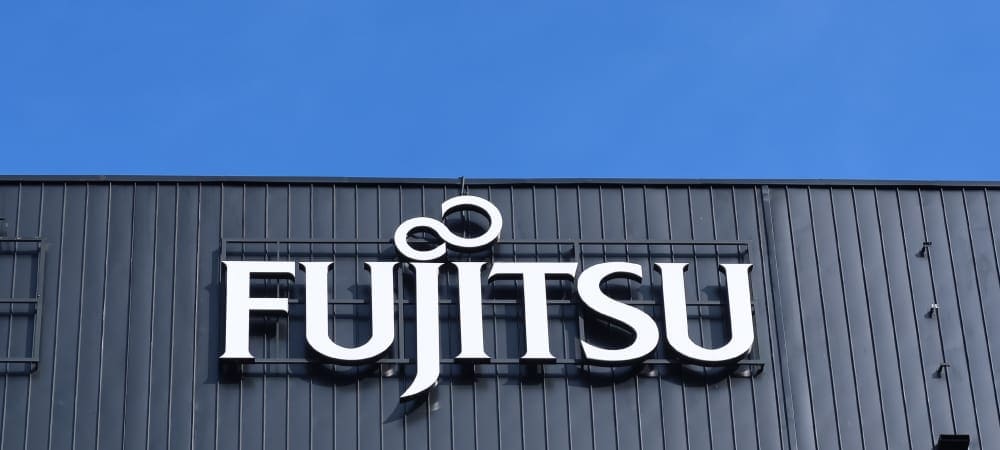

E3: Fujitsu BestPlace verspricht, den besten Ort für jede SAP-Instanz einer Umgebung zu finden. Wie läuft das in der Praxis ab?
Hendrik Müller, Fujitsu: In der Praxis sprechen wir von „Workload Placement“, also der optimalen Verteilung von SAP-Instanzen in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. Die Platzierungsentscheidungen sind in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Neben dem klassischen On-Prem-Betrieb bieten Hyperscaler und SAP selbst eine Vielzahl an Betriebsumgebungen an. Gartner beschreibt dies als eine „Explosion of Work-load Deployment Options“ und warnt, dass falsche Platzierungen hohe Betriebskosten, Performance-Probleme oder sogar eine Gefährdung der Business Continuity nach sich ziehen können. Daher muss Workload Placement daten- und anforderungsorientiert erfolgen. Da sich Anforderungen und SLAs über die Zeit ändern, ist es eine wiederkehrende Aufgabe. Gartner schätzt, dass 85 Prozent der heute getroffenen Platzierungsentscheidungen in fünf Jahren nicht mehr optimal sein werden.

Dr. Hendrik Müller, Lead Enterprise Architect Global SAP and Fujitsu Distinguished Engineer, Fujitsu
E3: Was bedeutet hier optimal? Wie können bestehende SAP-Systeme optimal in der Cloud platziert werden?
Jörg Niopek, Fujitsu: Wie so oft in unserer Branche hängt die Antwort von den spezifischen Anforderungen ab. Was für einen Kunden ideal ist, kann für einen anderen unpassend sein. Jeder Kunde und jedes System hat individuelle strategische, organisatorische und operative Anforderungen, die sich teils widersprechen können. Für Produktivsysteme ist eine optimale Platzierung darauf ausgerichtet, Verfügbarkeit und Performance zu maximieren, während die Kosten minimiert werden sollten. Ein entscheidender Faktor ist der Netzwerkverkehr zwischen den Systemen. In einer On-Prem-Umgebung spielt dieser für die Kosten keine Rolle, in hybriden Cloud-Umgebungen kann er jedoch ein wesentlicher Kostentreiber sein. Eine clevere Platzierung kann diese Kosten minimieren.
E3: Ist das Problem wirklich so komplex, dass es dafür einen Algorithmus braucht?
Müller: Ja, denn die Anzahl der möglichen Platzierungskombinationen ist enorm. Wenn wir zum Beispiel von zwölf SAP-Systeme, 54 Regionen in Azure, zwei On-Prem-Rechenzentren und zwei weiteren Platzierungsoptionen innerhalb von Rise with SAP ausgehen, dann ergeben sich 1,45 Trillionen potenzielle Lösungen. Zwar sind viele aufgrund von Nebenbedingungen nicht valide, bleibt es ein Optimierungsproblem, das manuell nicht in vertretbarer Zeit gelöst werden kann. Zudem gibt es eine menschliche Komponente: Fragt man drei Berater nach der optimalen Lösung, erhält man oft drei unterschiedliche Antworten. Auch Microsoft, AWS und SAP haben jeweils eigene Sichtweisen. Um der Gefahr einer voreingenommenen Lösung zu entgegnen, verfolgt Fujitsu einen datengetriebenen Ansatz, der spezifische Workloads und Anforderungen des Kunden in den Mittelpunkt stellt.
E3: Wie lösen Sie dieses Problem?
Müller: Wir automatisieren die Lösungsfindung. Dazu setzen wir Optimierungsalgorithmen ein. Workload Placement ist ein eigenes Forschungsgebiet, das oft auf Heuristiken setzt. Diese sind für komplexe Geschäftsanwendungen jedoch ungeeignet, da Platzierungsbedingungen aufwendig implementiert werden müssen. Stattdessen setzen wir auf genetische Algorithmen, die nach dem Prinzip „Survival of the Fittest“ arbeiten. Der Algorithmus simuliert eine Mini-Evolution: Er generiert eine Menge zufälliger Lösungen, bewertet diese und entwickelt sie durch Mutationen und Rekombinationen weiter. Über mehrere Generationen hinweg entstehen so optimierte Lösungen. Ein Selektionsverfahren sorgt dafür, dass vielversprechende sowie einige suboptimale Lösungen weiterentwickelt werden, um den Lösungsraum umfassend zu durchsuchen.
E3: Und wer bewertet danach die Lösung?
Müller: Die Bewertung erfolgt über eine Fitness-Funktion. Je besser die „Fitness“, desto passender ist die Lösung. Nebenbedingungen des Kunden werden durch eine Penalty-Funktion berücksichtigt. Anstatt ungültige Lösungen sofort auszuschließen, werden sie bestraft, um lokale Optima zu vermeiden und das globale Optimum zu finden. Am Ende steht eine optimale hybride Lösung, die wir dem Kunden präsentieren und auf Wunsch mit Alternativen wie einer reinen On-Prem- oder 100-prozentigen Azure- oder Rise-Lösungen vergleichen.
E3: Welche konkreten Ergebnisse und welche Handlungsempfehlungen liefert BestPlace?
Niopek: BestPlace liefert eine Referenzarchitektur für eine optimale hybride SAP-Infrastruktur. Dazu gehören eine kostenoptimierte Platzierung, ein passendes Sizing und ein detaillierter Kostenvergleich für Compute, Storage, Network, Lizenzen und Betriebskosten. Alle erhobenen Daten stehen dem Kunden für spätere Analysen zur Verfügung.

Jörg Niopek, Business Development Manager, Consulting Infrastructure Solutions SAP, Fujitsu
E3: Sie sprechen von einem datengetriebenen Service. Woher stammen die Daten?
Niopek: Um unseren Service optimal auszurichten, müssen wir zwei zentrale Aspekte verstehen: erstens die Workloads jeder einzelnen SAP-Instanz und zweitens die Anforderungen der dazugehörigen Systeme und Organisationen. Direkt nach dem Projekt-Kick-off starten wir eine umfassende Messung. Dabei setzen wir eine Software innerhalb der Kundenumgebung ein, die über SAP-Standardschnittstellen mit allen relevanten Systemen verbunden wird. So erfassen wir essenzielle Daten zu Kapazitäten, Ressourcenverbrauch und Nutzungsmustern. Parallel dazu führen wir mit unseren Kunden zwei Workshops durch: Bei einem Strategieworkshop ordnen wir die SAP-Systeme passenden Anforderungsprofilen zu und definieren strategische, operative sowie organisatorische Bedürfnisse. Im Kostenworkshop verfeinern wir gemeinsam mit dem Kunden unser Kostenmodell, um individuelle Faktoren zu berücksichtigen. Dadurch können wir nicht nur Infrastrukturkosten präzise analysieren, sondern auch Betriebs- und Standortkosten gezielt vergleichen.
E3: Welche unterschiedlichen Kundenherausforderungen spielen dabei eine Rolle?
Müller: Am Ende geht es für den Kunden und die Fachabteilungen vor allem um die Erfüllung von SLAs. Kapazitätsmanagement bedeutet, Anforderungen kosteneffizient zu erfüllen, ohne die Performance zu gefährden. Dafür müssen wir sowohl die technischen als auch die organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen genau verstehen. Technisch betrachtet geht es um die Ressourcenpuffer beim Sizing, die Verfügbarkeit der Systeme, Anforderungen an den Datendurchsatz sowie die Backup- und Disaster-Recovery-Strategien. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass die potenziellen Betriebsumgebungen die spezifischen Anforderungen der Systeme abbilden können. Auf der organisatorischen und strategischen Seite spielen der Stellenwert der IT für den Unternehmenserfolg und der Innovationsgrad eine Rolle. Es ist ebenfalls entscheidend, welche Expertise bereits im Unternehmen vorhanden ist, beispielsweise im Bereich Cloud-Architektur oder -Betrieb, da dies den späteren Betrieb und die Effizienz beeinflusst. Betriebswirtschaftlich müssen wir bei jeder potenziellen Zielumgebung die Frage klären: Welche Anforderungen lassen sich zu welchen Kosten in welchem Umfang erfüllen? Diese Kombination aller Anforderungen und Möglichkeiten macht die Lösung zwar komplex, aber auch entscheidend für eine zukunftsfähige und effektive Platzierung der Workloads.
E3: Wie unterscheidet sich BestPlace von anderen Tools?
Niopek: BestPlace ist kein Tool, sondern ein Beratungsservice. Monitoring-Tools gibt es viele, doch unser Mehrwert liegt in der Kombination aus Messung und Analyse. Wir interpretieren die Daten und leiten konkrete Handlungsempfehlungen ab. Wo es sinnvoll ist, unterstützt KI unsere Analysen, etwa durch zunächst öffentlich verfügbare Informationen.
E3: Wie kann eine optimale Platzierung von SAP-Workloads mit Rise erreicht werden?
Müller: Auch wenn Rise with SAP über ein reines IaaS-Angebot der Hyperscaler hinausgeht, bleibt unser Prinzip unverändert: Die Anforderungen der Kunden-Workloads stehen im Mittelpunkt. Auf dieser Basis prüfen wir, in welchen Szenarien ein Rise-Vertrag sinnvoll ist. Ein zentraler Kostenfaktor ist dabei der FUE-Bedarf (Full-Use Equivalent), den wir detailliert erfassen. Anschließend analysieren wir, welche zusätzlichen Infrastrukturkomponenten erforderlich sind – etwa höhere Verfügbarkeitsklassen, erweiterte Disaster-Recovery-Anforderungen oder längere Backup-Aufbewahrungszeiten. Für die Bewertung setzen wir – wie bei allen Platzierungsoptionen – zunächst öffentlich verfügbare Informationen an. Falls dem Kunden bereits individuelle Angebote vorliegen, können diese entsprechend berücksichtigt werden. So stellen wir sicher, dass die Workloads optimal platziert werden – sowohl technisch als auch wirtschaftlich.
E3: Wie stellt sich das Ganze aus lizenztechnischer Perspektive dar?
Niopek: Je vielfältiger die Anforderungen, desto komplexer wird die Lizenzierung. Entscheidend ist weniger die Anzahl der Systeme als deren Heterogenität. Daher richten sich die Kosten eines BestPlace-Projekts nach der Anzahl der definierten Anforderungsprofile. Besonders für mittlere und große SAP-Umgebungen skaliert dieser Ansatz gut, da zusätzliche Systeme bestehenden Profilen zugeordnet werden, ohne weitere Kosten zu verursachen. Unser Ziel ist es, die späteren Betriebskosten zu minimieren. Ein erhöhter Planungsaufwand in der Designphase führt in der Regel zu Kosteneinsparungen und verhindert unerwartete Mehrausgaben – den sogenannten „Cloud Bill Shock“. Erfahrungsgemäß sind Korrekturkosten deutlich höher als Designkosten, weshalb sich eine detaillierte Planung lohnt.
E3: Welche weiteren Anwendungsfälle für KI-gestützte SAP-Beratung gibt es?
Müller: Unsere datengetriebenen Services können bereits Workloads vorhersagen und Performance-Anomalien identifizieren. Da wir seit über einem Jahrzehnt mit unserem eigenen Lab aktiv Forschung und Entwicklung in diesem Bereich betreiben und regelmäßig publizieren, sind wir stets offen für neue Use Cases. Wenn sich dabei echte Mehrwerte zeigen, integrieren wir die entwickelten Modelle gezielt in unsere Beratungsservices – etwa in den SystemInspection Service for SAP Solutions oder BestPlace. Unser neuestes Large Language Model (LLM) erklärt SAP-Transaktionen und erleichtert Performance-Analysen. In Zukunft könnten LLMs in Form digitaler Admins datenbasiert Entscheidungen vorbereiten und den Personalmangel in IT-Betriebsmannschaften abfedern.