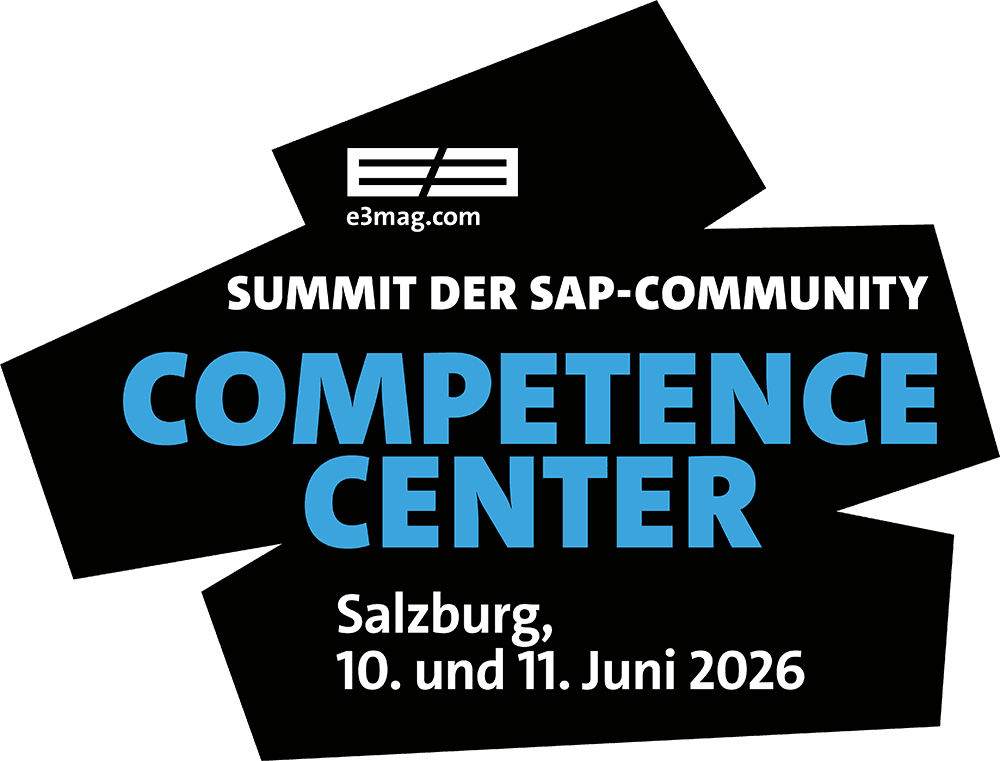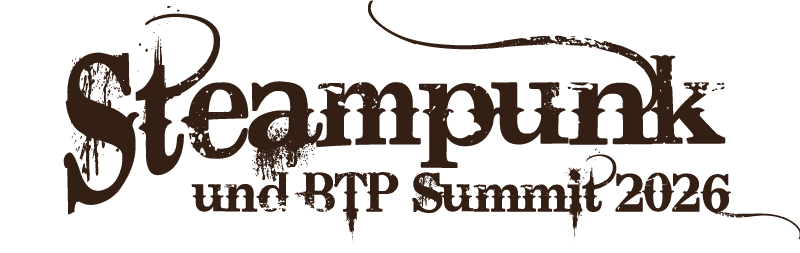EU-Wettbewerbsverfahren gegen SAP


Nach der vorläufigen Prüfung der Kommission kommt diese zum Ergebnis, dass insbesondere folgende Ansatzpunkte vorliegen, die einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach Artikel 102 AEUV durch SAP nahelegen:
SAP verpflichtet die Kunden, für ihre On-premises-ERP-Software Pflege durch SAP in Anspruch zu nehmen und nur ein Pflegemodell zu wählen. Kunden könnten so daran gehindert werden, Pflegeangebote verschiedener Anbieter zu mischen. Die AGB der SAP erlauben es zudem nicht, Pflegeverträge für ungenutzte Softwarelizenzen zu beenden, d. h., Teilkündigungen auszusprechen, wodurch die Kunden ggf. Pflege für Software zahlen müssen, die sie nicht benötigen.
Die Kommission kritisiert auch, dass SAP zum Teil längere Mindestlaufzeiten für Pflegeverträge vorsieht, während derer die Pflege nicht gekündigt werden kann. Auch dass SAP Kunden nach einer zwischenzeitlichen Pausierung der Pflege Reaktivierungsgebühren für die Wiederaufnahme berechnet, stößt auf rechtliche Bedenken. In einigen Fällen waren diese Gebühren so hoch wie der Betrag, den die Kunden gezahlt hätten, wenn sie die Leistungen ununterbrochen in Anspruch genommen hätten.
Verfahrensstand und mögliche Sanktionen
Die Einleitung eines Verfahrens bedeutet nicht, dass bereits eine Zuwiderhandlung durch die Kommission abschließend festgestellt wurde. SAP erhält die Möglichkeit zur Stellungnahme und hat nun im Übrigen die Möglichkeit, Verpflichtungszusagen zu unterbreiten, um die Bedenken der Kommission auszuräumen.
Sollte ein Verstoß festgestellt werden, kann die Kommission nach Art. 23 der Verordnung 1/2003 eine Geldbuße von bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen – bei SAP wären das mehrere Milliarden Euro. Zusätzlich kann sie Abhilfemaßnahmen anordnen, z. B. das Recht zur Teilkündigung von Pflegeverträgen in den AGB zu verankern, Reaktivierungsgebühren nach Unterbrechungen der Pflege abzuschaffen oder das Verbot von mehrjährigen Mindestlaufzeiten für Pflegeverträge. Bestandskunden, die sich bei SAP vertraglich eingeschränkt oder diskriminiert fühlen – z. B. bei der Nutzung von Drittwartungsanbietern oder bei durch SAP abgelehnten Teilkündigungen –, sollten diese Vorgänge intern dokumentieren. Die EU-Kommission bittet regelmäßig auch Kunden um Stellungnahmen oder Belege.
Auswirkungen auf Bestandskunden
Kunden haben insoweit auch die Möglichkeit, das Verfahren aktiv zu unterstützen. Falls bestimmte Klauseln in den SAP-Verträgen als kartellrechtswidrig eingestuft werden, müssten sie durch neue Vorgaben ersetzt werden. Kunden könnten daher Nachverhandlungen mit SAP für ihre Altverträge fordern und sollten gegenüber SAP darauf hinweisen, dass sie die als rechtswidrig eingestuften Klauseln nicht beachten werden.
Kunden, die derzeit SAP-Produkte (z. B. BTP, Rise oder S/4) implementieren, sollten die Vertragskonditionen genau prüfen – insbesondere hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit künftigen kartellrechtlichen Auflagen. Zwar betrifft das Kartellverfahren aktuell ERP-On-premises-Software. Gleichwohl dürften bestimmte Grundsätze auch auf Cloud-Verträge anwendbar sein. Ein positiver Ausgang des Verfahrens würde langfristig mehr Flexibilität und bessere Einsparpotenziale eröffnen. Wird ein Verstoß festgestellt, könnten betroffene Kunden ggf. auch zivilrechtlich Schadensersatz gegen SAP geltend machen.
Fazit
Das Verfahren stellt eine erhebliche rechtliche und wirtschaftliche Herausforderung für SAP dar. Für Bestandskunden birgt es Chancen: Sie könnten durch künftige regulatorische Vorgaben mehr Flexibilität, niedrigere Kosten und erweiterte Migrationsoptionen erhalten. Kurzfristig ist vor allem zur rechtlichen Prüfung laufender Verträge und geplanter Migrationen zu raten, um Risiken frühzeitig zu erkennen und vertragliche Anpassungen ggf. proaktiv zu verhandeln.