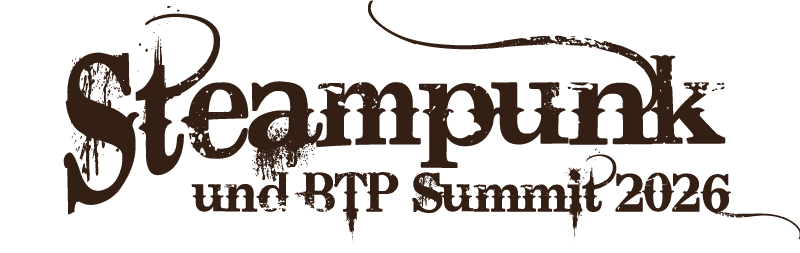SaaS – Schrecken oder Segen?


Wo die Vor- und Nachteile von SaaS in der Automation liegen
Wir sprechen von SaaS, wenn eine Software-Anwendung über eine Webapplikation in der Cloud zur Verfügung gestellt wird. Daten, Server und Wartung der Anwendung werden vom Anbieter direkt verwaltet. Dieses Modell stellt eine Alternative zur klassischen On-premises-Lösung dar, also der Anschaffung und Installation der Software in der eigenen IT-Umgebung.
SaaS: Auf dem Vormarsch
In den vergangenen Jahren erlebte SaaS einen triumphalen Siegeszug in den Unternehmen. Laut Gartner stiegen die Ausgaben für SaaS-Anwendungen von 2020 bis 2022 weltweit um 42 Prozent. Reüssierten in den Anfangstagen CRM- und Projektmanagement-Programme wie Salesforce mit SaaS, hat dieses Vertriebsmodell mittlerweile alle Bereiche der IT-Infrastruktur erreicht. Selbst komplexe Lösungen wie Workload Automation werden als Cloud-basierter Service angeboten. Das Housekeeping der Anwendung, eine zentrale Ebene bei komplexer Software, wird so vom Anbieter übernommen.
Der erste Grund ist technischer Natur: Schnelles und stabiles Internet ist in den Großstädten und Ballungsräumen mittlerweile flächendeckend vorhanden. Eine Grundvoraussetzung für SaaS. Im Umkehrschluss heißt das: Unternehmen, die in der Breitband-Diaspora sitzen, sollten wichtige Software-Anwendungen nicht über ein solches Modell beziehen.
Unternehmerischen Vorteile
Als Hauptargument gilt die Skalierbarkeit der Software. Die meisten SaaS-Lösungen werden in verschiedenen Umfängen und Lizenzierungsmodellen angeboten. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen erhalten die Software, die sie für ihre Prozesse benötigen – und keine aufgeblasene Gesamtlösung. Das ist einerseits preiswerter, andererseits erleichtert es die Anwendung und den Betrieb. Denn die Wartungs-, Monitorings- und Backup-Aufgaben liegen beim Dienstanbieter; er ist für das Laufen der Anwendung verantwortlich. So ist SaaS auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel in der IT-Branche. Die Unternehmen benötigen für Installation, Pflege und Monitoring keine eigenen Kräfte mehr. SaaS-Dienste bieten zusätzlich Reporting- und Intelligence-Tools an. Auch darum müssen sich die Unternehmen nicht mehr kümmern. Zudem ist das Software-Set-up preiswerter. Der initiale und laufende Aufwand ist um einiges geringer – sowohl technisch als auch finanziell und personell.
Technologisch sind SaaS-Lösungen mittlerweile so weit, dass sie sich in bestehende Systeme einbinden lassen. Eine Kollision mit anderer Software tritt nur vereinzelt auf.
SaaS-Falle vermeiden
Warum scheuen dann einige Unternehmen das Software-Modell? Sind sie blind? Nicht unbedingt. Denn SaaS birgt Risiken. Diese lassen sich unter den Begriffen „Abhängigkeit“ und „Sicherheit“ zusammenfassen.
Betrachten wir die Abhängigkeiten: Wer sich für eine Lösung entschieden hat, kann später nur schwer umsteigen. Stichwort: Vendor-Lock-in. Sprich: Der Kunde ist derart von der Software des Anbieters abhängig, dass sich der Wechsel zu einem Mitbewerber wirtschaftlich nicht rechnen würde – selbst bei steigenden Software-Kosten durch den SaaS-Anbieter. Denn dann treten Probleme auf. Was passiert mit den Daten? Ist eine Migration in ein anderes System möglich? Oder entsteht zerstörerisches Datenchaos?
Es gibt weitere Unsicherheiten: Was geschieht, wenn der Anbieter seinen Dienst einstellt, vom Markt verschwindet oder von einem Wettbewerber übernommen wird? Oft tauchen Komplikationen auf, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Selbst bei großen Playern. So lief Office365 zuerst über T-Systems. Dann kündigte Microsoft die Partnerschaft. Die Folge: Für die Kunden entstanden Mehrkosten von 20 Prozent und die Daten waren nicht mehr DSGVO-konform gelagert.
Ferner lauern Gefahren bei Updates. Wie lange gibt es Updates und muss die IT jedes Updaten mitmachen? Mitunter führen Updates zu Problemen mit der historisch gewachsenen Anwendung, da die „Legacy-Schnittstellen“ nicht mehr mit der Software harmonieren. Oder nach einem Update fallen Features weg, auf die sich das Unternehmen verlassen hat. Im Prinzip gibt man die Kontrolle über sein System aus der Hand.
Ein weiterer Punkt betrifft die Komplexität und den damit verbundenen Risiken. Die Infrastruktur ist bei SaaS normalerweise komplexer, da die Einbindung eines externen Services über deutlich mehr Knoten läuft. Zudem werden mehr Freigaben, zum Beispiel für Firewalls, benötigt. Es entstehen mehr Single Point of Failure (SPOF), also Ausfallpunkte für das Gesamtsystem. Gerade bei Migrationen wird dies sichtbar.
Hinzu kommt, dass bei zeitkritischen Katastrophenszenarien die Eingriffsmöglichkeiten eingeschränkt sind; es fehlt eine zentralisierte Kontrollinstanz. So kann der SaaS-Anbieter die Rettung meist nicht beschleunigen. Vertraglich vereinbarte Lösungszeiten sind entweder zu lang oder werden ausgehebelt. Überhaupt laufen SaaS-Anwendungen oft langsamer als Client-Lösungen.
Das Themenfeld „Sicherheit“ betrifft nicht nur die Datensicherheit, sondern auch die von Geschäftsgeheimnissen. Soll wirklich die wichtige IT-Infrastruktur ausgelagert werden? Legen Unternehmen nicht wertvolles, gar brisantes Wissen in die Hände Dritter?
Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Als Faustformel kann gesagt werden: Je wichtiger die Software-Anwendung für das Unternehmen ist, desto sorgfältiger muss zum einen der Einsatz von SaaS, zum anderen der SaaS-Anbieter geprüft werden.
Hier sind wir beim Thema: Automation. Automatisierungsprozesse sind oft entscheidend für den Betrieb. Sind diese gestört, können etwa Bestellungen nicht verarbeitet werden. Das Lagermanagement funktioniert nicht mehr. Oder Abrechnungen können nicht mehr gestellt werden. Im schlimmsten Fall steht der gesamte Betrieb still.
Das betrifft nicht nur das Laufen der Anwendungen, sondern auch das Wissen dahinter: Wird es nicht mehr inhouse geteilt und weitergegeben, so führt es kurz oder lang zum Verlust. Stichwort: Brain-Drain. Ein Unternehmen, das bei Kernprozessen abhängig ist vom Know-how Dritter, ist vulnerabel. Und es schließt sich selbst von eigenen Weiterentwicklungen aus. Somit verliert es vielleicht einen Wettbewerbsvorteil.
Leichtfertig sollten Unternehmen ihre Automatisierungsprozesse also nicht auslagern. Wer sich dennoch für SaaS entscheidet, weil die Vorteile für ihn überwiegen beziehungsweise er im Betrieb gar nicht über das Know-how verfügt, der sollte im Vorfeld Fragen klären, die sich aus den Themenfeldern „Technik“, „Service“, „Compliance“ und „Contracting“ ergeben.
Bei der Technik stehen Fragen zur Funktionalität im Vordergrund. Erfüllt die Software die gewünschten Anforderungen? Gibt es Individualisierungsmöglichkeiten? Wie sieht es mit Schnittstellen aus, speziell Legacy-Schnittstellen? Wo sind die Daten gelagert, wie sind sie gesichert und wer hat Zugriff? Diese Fragen überschneiden sich mit Punkten zur Compliance und dem Service wie: Welcher Akteur darf wie viel? Was leistet der Serviceanbieter in puncto Wartung und Entwicklung? Was passiert nach Kündigungen mit den Daten? Wie lange werden sie bewahrt? Hier sind wir beim Vertrag. Der dreht sich nicht nur um die Kosten, sondern ebenfalls um Laufzeit, Kündigungsfristen und Up- und Downgrades.
Im Detail können – insbesondere kleinere und mittlere – Unternehmen diese Fragen nicht vollumfänglich beantworten. Bei komplexen Software-Anwendungen sollte eine unabhängige Beratung mit ins Boot geholt werden.
Wie bei allen komplizierten Dingen im Leben gibt es bei der Beantwortung der Frage, ob SaaS für Automatisierungsprozesse geeignet ist, kein klares „Ja“ oder „Nein“, sondern ein: Es kommt drauf an.